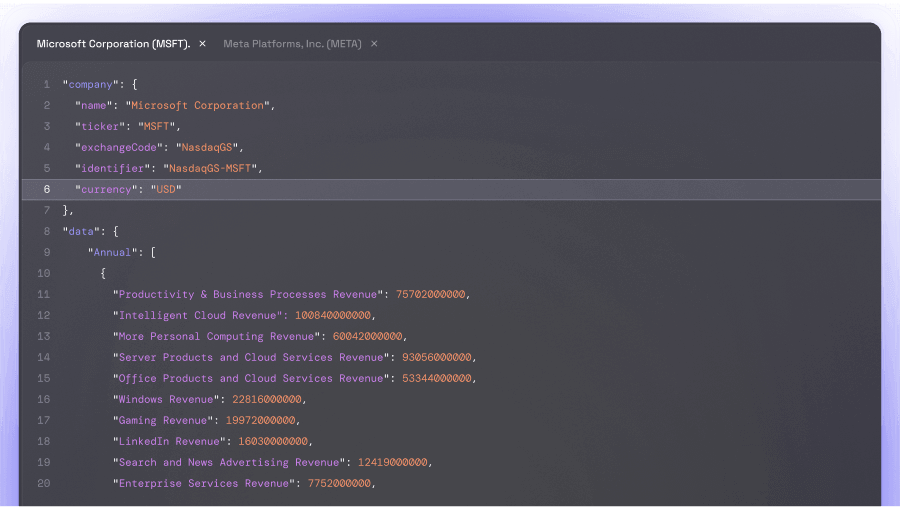Das rote Tesla Model S auf der Hebebühne ist ein Sinnbild für ein wachsendes Problem: Immer mehr E-Autos rollen auf Deutschlands Straßen, doch ihre Reparatur überfordert viele Werkstätten. Hochvolt-Technik, fehlende Schulungen und mangelnde Diagnosemöglichkeiten führen dazu, dass Kunden abgewiesen oder ganze Baugruppen ausgetauscht werden – oft zu immensen Kosten. Laut Gesamtverband der Versicherer liegen die Reparaturkosten von Elektroautos im Schnitt rund 25 % höher als bei Verbrennern.
Besonders brisant: Das neue EU-weite „Recht auf Reparatur“ gilt nicht für Autos. Hersteller sind somit nicht verpflichtet, Ersatzteile langfristig vorzuhalten oder Komponenten reparierfähig zu gestalten. Kritiker wie SPD-Politiker René Repasi sprechen von einem Sieg der Autolobby, die im Parlament weitreichende Ausnahmen durchsetzte.
In diese Lücke stoßen Spezialisten wie Otto Behrend, Gründer der Berliner „EV Clinic“. Sein Team nimmt sich Fällen an, bei denen Vertragswerkstätten längst aufgeben – bis hin zum Austausch einzelner Batteriezellen, die Hersteller eigentlich nur komplett ersetzen. Ergebnis: ein Bruchteil der Kosten und ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Doch die Nachfrage übersteigt die Kapazitäten bei weitem: Acht Wochen Wartezeit sind Standard, bundesweit gibt es nur eine Handvoll solcher Werkstätten.
Für Kunden bedeutet das: Wer außerhalb der Garantie mit Defekten konfrontiert wird, muss mit hohen Kosten und langen Wartezeiten rechnen. Für Investoren wiederum zeigt sich ein Markt im Umbruch: Während Hersteller weiter auf teure Austauschstrategien setzen, entsteht ein neues, hochprofitables Segment für unabhängige Spezialbetriebe – ein Geschäftsfeld, das gerade erst beginnt, sich zu formieren.