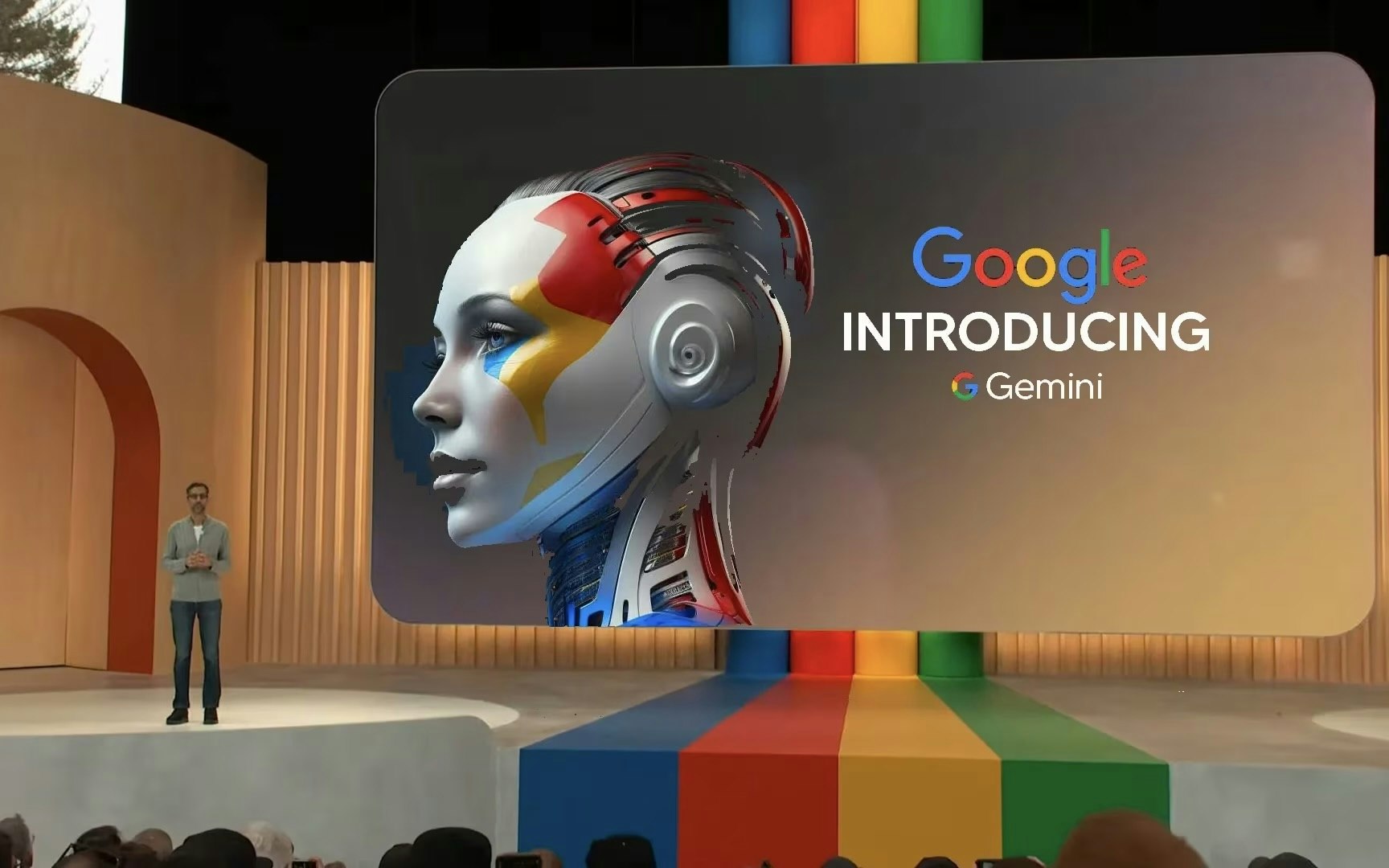Sabine Mauderer, Vizepräsidentin der Bundesbank und Vorsitzende des Network for Greening the Financial System (NGFS), hat die Rolle der Notenbanken beim Klimaschutz verteidigt und eingeräumt, dass Aufseher die finanziellen Risiken des Klimawandels lange unterschätzt hätten. „Wir haben über Jahre komplett unterschätzt, wie stark physische Risiken auch entwickelte Volkswirtschaften treffen können“, sagte Mauderer der Financial Times.
Mauderer verwies darauf, dass Zentralbanken „unpolitische Technokraten“ seien, deren Interesse sich zwangsläufig dort verstärke, wo neue finanzielle Risiken entstehen. Die jüngste Analyse des NGFS prognostiziert einen Rückgang des globalen BIP um bis zu 15 Prozent bis Mitte des Jahrhunderts, selbst wenn die bestehenden Klimaziele eingehalten würden. Die wirtschaftlichen Schäden durch höhere Temperaturen, extremen Niederschlag oder Naturkatastrophen seien im Vergleich zur Vorjahresstudie bereits vervierfacht worden.
Die Modelle des NGFS, das 2017 von Notenbanken wie der Bank of England, der Banque de France und der People’s Bank of China gegründet wurde, bilden heute die Grundlage für Stresstests zahlreicher Aufseher, darunter in Brasilien, China und der EU. Auch ohne die US-Notenbank Fed, die im Januar wegen angeblicher Kompetenzüberschreitungen aus dem Netzwerk austrat, wachse die Bedeutung der Organisation, so Mauderer.
US-Präsident Donald Trump hatte den Klimawandel zuletzt erneut als „teuren Schwindel“ bezeichnet. Die Fed begründete ihren Austritt mit der Ausweitung des NGFS über den eigenen gesetzlichen Auftrag hinaus. Auch US-Regulierer fordern, das Basel Committee on Banking Supervision solle seine Klimaaktivitäten reduzieren.
Innerhalb der G20-Finanzaufsicht Financial Stability Board (FSB) herrscht Uneinigkeit, ob es weiterer Arbeiten zum Thema Klimarisiken bedarf. Das FSB kündigte an, künftig jährlich zu prüfen, ob neue Projekte notwendig seien.
Mauderer warnte indes, dass weitere Iterationen der NGFS-Modelle vermutlich noch gravierendere Risiken offenbaren würden. Bisher unberücksichtigt blieben Folgen von Wasserknappheit, dem Zusammenbruch von Bestäubungssystemen, Massenmigration sowie Kipppunkte im Klimasystem, die irreversible Veränderungen auslösen könnten.
Die UN hatte zuletzt vor einem „katastrophalen“ Temperaturanstieg von mehr als 3 Grad gewarnt. Extremwetter könne Inflation durch Produktionsausfälle anheizen und Rückzüge von Versicherungsdeckung forcieren – mit direkten Folgen für Immobilienmärkte und Finanzstabilität.